Rezensionen und Lesetipps
An dieser Stelle weisen wir Sie auf Bücher hin, die auf verschiedensten Wegen zu uns gefunden haben.
Vielleicht können wir mit unseren Besprechungen Ihr Interesse wecken, sie ebenfalls zu lesen.
Rezensionen eingrenzen
Ich bin so knallvergnügt erwacht. Die besten Gedichte
von Joachim RingelnatzRezension von Karl Forcher
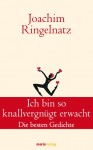 Am stillen Orte
Am stillen Orte
ertönen Worte
von Poeten und anderen Schreiberlingen
um die Sitzungszeit weiterzubringen.
Auch Handke schrieb vom stillen Orte,
Hans Bäck schrieb drüber kritisch Worte
in seiner Nachlese.
Ich, ohne Späße,
lese laut Dichterwerke in einem fort,
wenn länger die Sitzung am Abort.
Jüngst fand ich bei Morawa
in der Ecke der Billigwar'
einen ganz speziellen Schatz
von Joachim Ringelnatz:
„Ich bin so knallvergnügt erwacht“
da wird sehr oft herzhaft gelacht,
doch sind nicht billig diese Scherze,
sie gehen, ich gesteh's, oft wohl zu Herze.
Darum, ihr Leser, nicht verweilt,
zum nächsten Bücherladen eilt,
um knallvergnügt dann zu erwachen
beim Ringelnatz'schen Reimemachen.
Die Entdeckung der Langsamkeit
von Sten NadolnyRezension von Karl Forcher
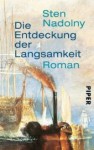 „John Franklin war schon zehn Jahre alt und noch immer so langsam, dass er keinen Ball fangen konnte“
„John Franklin war schon zehn Jahre alt und noch immer so langsam, dass er keinen Ball fangen konnte“
So beginnt Sten Nadolnys Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit.“
Was kann aus einem solchen Jungen wohl anderes werden als ein Versager?
Doch weit gefehlt: Dieser Junge, John Franklin, wird Seefahrer und kämpft mit der britischen Marine bei der Schlacht von Kopenhagen 1801. Dieser Junge, der in seiner Bedächtigkeit so stark und beständig ist, macht sich mit zwei Schiffen auf die Suche nach der legendären Nordwestpassage. Ihm gelingt nach Aufgabe der Schiffe der Marsch durch die eisige kanadische Wildnis, das Überleben trotz widrigster Umstände.
Dieser Junge wird in reifen Jahren Gouverneur der Sträflingskolonie Tasmanien. Zu guter Letzt bricht er nochmals auf, um die Nordwestpassage zu finden – und verschwindet spurlos im ewigen Eis.
1983 veröffentlichte Sten Nadolny seinen Bestseller. Gemäß dem Motto Langsamkeit habe ich das Buch im Dezember 2008 bei Donauland gekauft und 2012 gelesen – und war begeistert. Wenn Sie es noch nicht gelesen haben – tun Sie es! Aber lassen Sie sich Zeit, überstürzen Sie nichts! Bestaunen Sie Nadolnys Sätze auf der Spur des tolpatschigen Jungen, der zum Helden wurde, in angemessener Langsamkeit. Hudeln Sie nicht!
Vom Ende einer Geschichte
von Julien BarnesRezension von Karl Forcher
 Tony Webster, pensioniert und geschieden, hat eine mehr oder weniger erfolgreiche Berufskarriere hinter sich, als ihn eine Erbschaft zwingt, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Sarah Ford, die Mutter seiner Jugendliebe Veronica, vererbt ihm 500 Pfund – und das Tagebuch seines Jugendfreundes Adrien Finn. Die Freundschaft endete einst, als Adrien, erfolgreicher Cambridge-Student, eine Beziehung mit Veronica einging und Tony darauf mit einem höchst beleidigenden Brief an beide reagierte, obwohl er bereits zuvor mit ihr Schluss gemacht hatte. Kurze Zeit später hatte Adrien aus Lebensüberdruss Selbstmord begangen.
Tony Webster, pensioniert und geschieden, hat eine mehr oder weniger erfolgreiche Berufskarriere hinter sich, als ihn eine Erbschaft zwingt, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Sarah Ford, die Mutter seiner Jugendliebe Veronica, vererbt ihm 500 Pfund – und das Tagebuch seines Jugendfreundes Adrien Finn. Die Freundschaft endete einst, als Adrien, erfolgreicher Cambridge-Student, eine Beziehung mit Veronica einging und Tony darauf mit einem höchst beleidigenden Brief an beide reagierte, obwohl er bereits zuvor mit ihr Schluss gemacht hatte. Kurze Zeit später hatte Adrien aus Lebensüberdruss Selbstmord begangen.
Tony, der Sarah Ford in längst vergangenen Studententagen bei einem Wochenendbesuch in Victorias Elternhaus kennenlernte, will das Tagebuch natürlich haben. Doch das hat Veronica – und will es nicht herausgeben. Über Veronicas Bruder Jack kommt Tony zu ihrer Emailadresse, schließlich kommt es zum Treffen und er erhält eine kopierte Seite aus Adriens Tagebuch. Immer weiter steigert er sich in diese längst vergangene Geschichte – und muss zum Schluss sehr überraschende Tatsachen zur Kenntnis nehmen.
Julian Barnes erzählt aus der Sicht Tony Websters, der sich im ersten Teil seiner Jugend erinnert. Aber mit jeder neuen Erfahrung muss er feststellen, dass vieles nicht so war, wie er sich zu erinnern glaubte. Sowohl ihn selbst, als auch das sich über den gewöhnlichen Menschen erhebende Genie Adrien Finn, betreffend.
Spannend und großartig erzählt. Ich habe das Buch in zwei Zügen über die Osterfeiertage gelesen.
Vom Ende einer Geschichte
Julien Barnes
Verlag Kiepenheuer & Witsch
Psalmen
von Helmut Stefan MilletichRezension von Karl Mittlinger
Erste bis fünfte Folge, 1 bis 90. edition hic@hoc, plattXform Johannes Martinek Verlag, Perchtoldsdorf 2010 (2. Aufl. 2011), 168 Seiten, ISBN 978-3-9502885-3-7;
 „Der Psalm ist eine Redeform, mit der die menschliche Sprache in Richtung Gott transzendiert“ (Paul Konrad Kurz).
„Der Psalm ist eine Redeform, mit der die menschliche Sprache in Richtung Gott transzendiert“ (Paul Konrad Kurz).
In der Sammlung „HöreGott! Psalmen des Jahrhunderts (Benziger Verlag 1997) von K. P. Kurz fehlen die Psalmen von Helmut Stefan Milletich, obwohl sie bereits 1989/90 geschrieben wurden, aber erst 2010 ediert wurden. Schade, einige hätten es verdient, aufgenommen zu werden. Etwa:
Singt dem Herrn ein neues Lied;
und David, im Gitterbett,
greift in die Saiten
der Leiter, die ihn, links und rechts,
im Bett gefangen hält,
weil er ins Delirium gefallen ist… (S. 17)
Diese Psalmen greifen einerseits die Themen des hebräischen Psalters auf, vergegenwärtigen sie und flechten andererseits Alltagsthemen ins Gebet eines Zeitgenossen ein, der sich meditierend in die großen Geheimnisse vertieft, so sind die Psalmen 54 bis 69 zu Passion und Auferstehung geschrieben.
Haben die ersten Psalmen noch Gott als direkten Ansprechpartner vor Augen, so verliert sich das Du in den späteren Texten zusehends, es treten innere Monologe und Selbstbeschwörungen an die Stelle, reich an kräftigen Bildern sind die Beobachtungen des täglichen Lebens, besonders schön zu beobachten ist dies am 73. Psalm.
Wehmütig liest man diese Psalmen, sie künden von einer Zeit, in der Menschen sich an Gott gewendet haben, betend, grübelnd, klagend und bewundernd, einer vergehenden Generation zugehörig, ein Abgesang religiösen Suchens und Betens – was nicht gegen den Wert dieser Texte gesagt ist, aber der Faden ist gerissen, die Jungen singen rhythmische Lieder, die sich in der heutigen Zeit viel vorgestriger anhören und die anderen haben sich längst abgewendet.
In diesen Texten ist ein sprachmächtiger Poet zu vernehmen, der mit mystischem Blick den Dingen auf der Spur ist bis in jene Gefilde hinein, die sich nur den Betern auftun.
Ich bin dankbar, diesen Texten begegnet zu sein.
Karl Mittlinger
Lautsprecher in den Bäumen
von Hans BäckRezension von Matthias Mander
Roman
253 Seiten
Euro 17,50
Kulturmaschinen Verlag, Berlin
ISBN 978-3-940274-31-1
 Ein Titel für diese Rezension könnte etwa lauten: Vom Stahlbad zwischen Vivaldi und Canaletto oder das Beginnen neuer Vergangenheiten*) mit Celia, Anna und Irina… - ein Prachtroman des Siebzigers, Ästheten und Organisators Hans Bäck aus Kapfenberg
Ein Titel für diese Rezension könnte etwa lauten: Vom Stahlbad zwischen Vivaldi und Canaletto oder das Beginnen neuer Vergangenheiten*) mit Celia, Anna und Irina… - ein Prachtroman des Siebzigers, Ästheten und Organisators Hans Bäck aus Kapfenberg
*) S. 41
Wenn ein derart erfahrener Herr sein erstes Prosabuch veröffentlicht, können seine Leser erwarten, dass der Roman bietet, was diese Literaturgattung erfordert: Pralle Fülle des Seins. Und sie werden nicht enttäuscht. Es ist alles da in kräftig strömender Breite. „Lautsprecher in den Bäumen“ enthält
1. Welthältigkeit (Weltmännlichkeit)
2. Wirtschaftswissen (Stahlwerk – Berater- Erfahrung) 40% des Textes
3. Kulturbildung (Kunstverstand)
4. Landschafts- und Stadtimpressionen
5. Frauenliebe und - probleme (40% des Textes)
6. Feinbeobachtungsblick, meditative Introspektion
7. Lebensfreude und - genuss
Dieses Werk – obwohl souverän geschrieben – bietet alle Genüsse eines Debütromans: Jedes Thema ist vollständig und ausgefeilt abgehandelt, nichts bleibt ausgespart oder verallgemeinernden Hinweisen überlassen. Und: Hans Bäcks Prosabuch schenkt auch viele schöne Lyrismen.
Aus den unter 4. und 6. erwähnten Schilderungen seien hervorgehoben: Eine russische 200.000 – Einwohner - Industriestadt am Fuß des Ural (S. 16 ff); deren winterliches Markttreiben (S. 170 ff!); orthodoxe Weihnachtsliturgie (S. 190 ff!!); kleinbürgerliche steirische Eisenbahnersiedlung samt hölzernem Wochenendhäuschen (S. 44 ff); Sonntagabend – Corso im Centro storico von Chioggia (S. 68 ff!); Venedigaufenthalte (S. 106 ff); Hochschwab - Besteigung (S. 129 ff!); intime Erinnerungen (S. 89 mit Titelmetapher, S. 114, S. 119, S. 249); sowjetischer Verbannungsort in Tadschikistan (S. 174 ff); Michelangelos Pièta Rondandini in Mailands Castello Sforzesco (S. 182, 183!!); Personal, Atmosphäre und Vokabular in Existenz entscheidenden Industriekonferenzen (z.B. S. 199 bis 218!).
Die Leser dieses Romans, mit einer neuen, literarisch durchaus erprobten österreichischen Stimme vorgetragen in so wertvollem vielschichtigem Realismus, dürfen sich ihren exemplarischen Anteil an Einblick und Aufklärung gegenwärtigen Daseinsabaufs erwarten. Und sie erhalten ihn auch. – Dank des unermüdlich umsichtigen Gipfelgehers Hans Bäck.
Matthias Mander
Einträge 36 bis 40 von 64 | Weitere ->
