Rezensionen und Lesetipps
An dieser Stelle weisen wir Sie auf Bücher hin, die auf verschiedensten Wegen zu uns gefunden haben.
Vielleicht können wir mit unseren Besprechungen Ihr Interesse wecken, sie ebenfalls zu lesen.
Rezensionen eingrenzen
Die späte Frau - und andere Romangeschichten
von Friedrich HahnRezension von Hans Bäck
Edition Lex Liszt, ISBN 978-3-99016-220-0
 Da hat nun wieder einmal einer zugeschlagen, bevor . . .
Da hat nun wieder einmal einer zugeschlagen, bevor . . .
ja, bevor „man“ als Autor selber dazu kam, diesen oder jenen Sager, Spruch, oder Idee aufzuschreiben und zu verarbeiten. Friedrich Hahn kam zuvor. Was da in den Romangeschichten unter dem Sammelnamen „Weil es nicht darauf ankommt - oder Davon kann nicht die Rede sein“
aufscheint, das wäre Material für ein Dutzend Autoren und ihre Arbeiten. Aber so ist es nun, der frühe Vogel frisst den Wurm und Friedrich Hahn hat sich auf eine Fülle von Sätzen vorerst einmal das Copyright gesichert. Und damit beispielsweise einen Satz wie <Rituale.Von sich selber abschreiben ist sich selbst plagiieren. Die literarische Form des Selfies….> für jede weitere Verarbeitung, Verwertung durch Kollegen unmöglich gemacht. Was würde ich geben dafür, den Satz <ich traue zum Beispiel schon lange keiner Wiese mehr über den Weg. Wer weiß schon, worüber das Gras, das darauf wächst, wachsen hat müssen. Wer weiß schon, was da vertuscht, was unter den Teppich, den Rasenteppich gekehrt werden sollte> frei verwenden zu können. Leider, wie gesagt, Hahn ist zuvorgekommen.
Die beiden Teile des Buches mit den Romangeschichten, welche die Titelgebende „Die späte Frau“ einrahmen, sind eine Fundgrube für Menschen, die einen kleinen (aber ausgeprägten) Hang zur gepflegten Bösartigkeit, nein nicht so krass, aber ein kleiner Hang zur Boshaftigkeit ist in den Sätzen nicht zu verleugnen. Ist ja auch schön und gut so, man fühlt sich als Leser gleich direkter angesprochen.
Doch nun zur Geschichte, zur Erzählung, zum Beginn eines Romans, einer Novelle. Alles könnte daraus werden. Da bleibt so vieles noch offen, da würde man gerne weiterlesen, weiterdenken, weiterschreiben. Was wird beispielsweise aus dem Sauber-Mann Alois, der eine Steuernachforderung von 22000 Euro erhält, pumpt er seine neue Flamme Dora an? Wie geht es mit Alice weiter, der Tochter der verstorbenen Schwester, die nun plötzlich die Adoptivtochter der 67jährigen Dora ist. „Ja ich werde in meinem Alter noch Mutter“ was, wie reagieren die Schnepfen weiterhin auf die neue Rolle, die sich Dora angeeignet hat. So viele Ansätze für die nächste Geschichte, den Folgeroman.
Gerne gelesen, auch wenn der Autor mir auf der Seite 8 ordentlich in die Seite boxt oder einen verborgenen Tritt aufs Schienbein verpasst. Da wurde der Rezensent unwillkürlich an die Jahre erinnert, als der Neusprech aus der Bundesrepublik auf unser Österreich herüber schwappte: Wir erinnern uns, da kamen die Liegen, die Spüle usw. plötzlich und veränderten nicht nur die Kataloge der Einrichtungshäuser, sondern auch unsere Gesprächsformen. Wer nun dachte, das sei vorbei, glücklicherweise blieb uns in dieser Zeit die Umwandlung des WC in hauptwörtlich gebrauchtes Zeitwort in der 1. Person EZ erspart, nein nicht vorbei! Lieber Friedrich Hahn musste das sein? Gleich nach dem herrlichen Spiel mit dem Sixpack vor dem Spiegel mit dem Sixpack Bier in der Hand folgt der Ort der Beschaffung: Die TANKE! Na, das tut weh! Da ist das „pusselige Befüllen“ des Tagesportionierer mit all den Pillen und Tabletten“ schon wieder harmlos. Aber der Autor tröstet den Leser, den Rezensenten anderseits wieder mit der konsequenten Verwendung von typisch österreichischen Ausrücken und Wortwendungen. So bleibt uns die Palatschinke erhalten. Gott sei Dank, und sogar wenn diese auf Wunsch der jungen Alice mit Nutella gefüllt wird. Das hat der Autor exzellent genau beobachtet. Ich kenne kein achtjähriges Mädchen, welches heute eine Palatschinke mit Marillen- oder Ribiselmarmelade haben möchte.
Seite 139: Der Traum war so groß, dass er den ganzen Raum ausfüllte. Ich würde sagen, das „Material ist so groß“, das daraus drei Romane entstehen könnten. So haben wir eine Romangeschichte vor uns, die eigentlich so richtig Spaß macht (trotz der Tanke auf Seite 8)
Wehre dich deiner Haut
von Sigrid UhligRezension von Hans Bäck
Kurzgeschichten
Engelsdorfer Verlag, Leipzig
ISBN 978-3-96145-263-7
 Wenigstens weiß ich jetzt, was es alles in der DDR nicht gab! Beispielsweise Rotwein-Werbung per Telefon mit anschließendem Vertreterbesuch, Vertragsveränderungen von Telefonanbietern, selbstständig agierende Pflegedienstleistungen, kompliziert zu bedienende Haushaltsgeräte und so vieles mehr. Dem österr. Rezensenten fällt erst beim Durchlesen dieser Kurzgeschichten auf, wie weit wir schon manipuliert werden, wie Verantwortung auf den Konsumenten abgeschoben wird. Gut, soweit die allgemeine Klage über die Auswüchse der Marktwirtschaft, die auch wir, die im Westen geborenen, kennen. Nur, uns ist das mehr oder weniger in Fleisch und Blut übergegangen, manche der geschilderten Vorkommnisse regen uns nicht mehr auf, wir haben uns daran gewöhnt, können damit umgehen. Nun kommt eine Pensionistin der ehemaligen DDR daher und hält uns einen Spiegel vor. Ist ja nicht so schlecht, von Dritter Seite erzählt zu bekommen, wie wir beschissen werden, uns bescheissen lassen und noch Danke dafür sagen.
Wenigstens weiß ich jetzt, was es alles in der DDR nicht gab! Beispielsweise Rotwein-Werbung per Telefon mit anschließendem Vertreterbesuch, Vertragsveränderungen von Telefonanbietern, selbstständig agierende Pflegedienstleistungen, kompliziert zu bedienende Haushaltsgeräte und so vieles mehr. Dem österr. Rezensenten fällt erst beim Durchlesen dieser Kurzgeschichten auf, wie weit wir schon manipuliert werden, wie Verantwortung auf den Konsumenten abgeschoben wird. Gut, soweit die allgemeine Klage über die Auswüchse der Marktwirtschaft, die auch wir, die im Westen geborenen, kennen. Nur, uns ist das mehr oder weniger in Fleisch und Blut übergegangen, manche der geschilderten Vorkommnisse regen uns nicht mehr auf, wir haben uns daran gewöhnt, können damit umgehen. Nun kommt eine Pensionistin der ehemaligen DDR daher und hält uns einen Spiegel vor. Ist ja nicht so schlecht, von Dritter Seite erzählt zu bekommen, wie wir beschissen werden, uns bescheissen lassen und noch Danke dafür sagen.
Diese Kurzgeschichten sind einerseits ein Hilferuf einer Pensionistin, die sehr wohl ein eigenbestimmtes Leben führen kann, sich in der Lage sieht, auf die geänderten Verhältnisse einzusteigen und trotzdem immer wieder an die Grenze der Zumutbarkeit gerät. Was ist nun zumutbar? Literaten haben ganz bestimmt die Aufgabe, ihren Finger auf Dinge zu legen, die sie nicht in Ordnung befinden, sie haben auch die Aufgabe, aufzuzeigen, welche Entwicklungen anstehen, was auf uns zukommt und einiges mehr. Sie haben aber sicher nicht die Aufgabe, die Welt zu verändern. Dazu sind die Literaten nicht geeignet, davon sollen sie auch die Finger lassen.
Sigrid Uhlig legt ihre Finger sehr wohl auf Unzukömmlichkeiten unserer Gesellschaft, zwischen den Zeilen trauert sie immer ein wenig der alten DDR nach, in der einfach Verschiedenes nicht vorkam, nicht vorhanden war, nicht möglich war. Herrlich ist der versteckte Hinweis im Vorwort, dass die neue Gesellschaftsordnung, wie sie nun vorgefunden wurde, in den Lehrgängen für Marxismus/Leninismus genau beschrieben und interpretiert war. Also hatte der Real Existierende Sozialismus doch recht? Man ist versucht, der Autorin dabei zu folgen. Als unbefangener Leser – das ist auch ein nichtbetroffener – muss man schmunzeln, wenn die Autorin den Alltag im neuen Westen-Wunder-Land schildert. Wie gesagt, wir sind es gewöhnt, haben gelernt damit umzugehen, wissen an welchen Stellen man „Wirbel machen muss“. Und nun sind da die Pensionisten des Staates, der sich um alles gekümmert hatte, wo für die Menschen ganz wenig übrigblieb, um ihre Eigeninitiative zu entwickeln. Fahrstuhlprobleme, Reparaturarbeiten, Handwerker die nicht kommen oder nur ungenau arbeiten, Krankheiten, die plötzlich auftreten und behandelt werden, wo man eine freie Arztpraxis aufsuchen muss/kann/darf.
Heiterkeit, aber nur für den Nicht-Betroffenen Österreicher, Ärger, Wut, Kummer für die vielen anderen? Auch das, aber es bleibt ein nostalgischer Abgesang auf eine untergegangene Welt. Ob da jeder nachtrauert, das fragt sich nach der Lektüre ein betroffen zurückbleibender Österreicher.
ASCHENFLUG - FLUGASCHE
von Ruth BargRezension von E X T E R N

LYRIK
edition keiper, Graz
ISBN 978-3-902322-24-0
Lauf nicht über
den frisch gefallenen Schnee,
lass doch die Gräser schlafen
und deine Augen weiden.
Als Mitglied diverser Autoren-Vereinigungen in Österreich und Deutschland beweist Ruth Barg mit ihrem nunmehr vierten Lyrik-Band wieder ihre sprachliche Virtuosität, ihre Fähigkeit tiefe Gefühle, tiefe Gedanken sowie beeindruckende Impressionen in anrührende Worte zu kleiden. Im Vorwort fand ich die Bezeichnung „kunstvoll einfach“. Dem schließe ich mich vollinhaltlich an: Wie in künstlerisch hochwertigen Pinselzeichnungen findet sich in jedem Gedicht mit wenigen Strichen ein vielschichtiges, ausdrucksstarkes Bild, das einen tiefgreifenden Eindruck hinterlässt. Allein schon im Wortspiel des Buch-Titels ist eine faszinierende Aussage enthalten.
Ein Büchlein, das man immer wieder gerne zur Hand nimmt, um mitzudenken, mitzufühlen und selbst in Texten, die von tiefer Trauer sprechen, noch von Hoffnung und Liebe lesen.
Rosemarie Kienmandl, „Verband Geistig Schaffender und Österreichischer Autoren“
Stella und Claude
von Martin StankowskiRezension von Hans Bäck
Roman, Verlag tredition Hamburg
ISBN 978-3-347-19442-7
 So einen herrlich unmodernen Roman gibt es ja heutzutage (fast) nicht mehr! Eine Wohltat nach der „Lektüre“ von div. „Dicht“heitsproblemen von Huf-, Sarg- und anderen Nägeln.
So einen herrlich unmodernen Roman gibt es ja heutzutage (fast) nicht mehr! Eine Wohltat nach der „Lektüre“ von div. „Dicht“heitsproblemen von Huf-, Sarg- und anderen Nägeln.
Über viele Seiten verfolgt den Rezensenten eine Erinnerung an lang zurückliegende Lesefreuden: Stifters „Witiko“ und dessen langjährige Annäherung an seine Braut Bertha und das sind ja keine schlechten Assoziationen! Eine Verbindung zu Stifter, nun, der Autor lebt ja zur Hälfte in Oberösterreich und als Schweizer steht es ihm auch zu, ein wenig „anders“ zu schreiben.
Wenn der Protagonist erzählt: „er hielt ihre leichte, gar nicht weiche Hand ein wenig länger in der seinen, sie wehrte nicht…“ dann ist das über weite Strecken der Höhepunkt der Erotik!
Claude Gutensohn, ein wohlbestallter Hochschullehrer für Kulturgeschichte kommt von einer Dienstreise nach Wien in seinen Wohnort zurück und beschließt noch auf einen Trunk in seine „Stammbeiz“ einzukehren. Der dort versammelte Gartenbauverein begrüßt den späten Gast herzlich, man freut sich über den prominenten und gebildeten Besucher, der immer wieder im Verein mit Vorträgen aufhorchen lässt und daher kein Unbekannter ist. Nach dem formellen Begrüßungstrunk beschließt Prof. Dr. Gutensohn aber, sich auf den Heimweg zu machen. Eine junge Frau, die am Rande des langen Tisches sitzt, bietet sich an, ihn zu begleiten. Und nun beginnt im Regen, im nächtlichen Nachhause-gehen eine Liebesgeschichte, vergleichbar eben der von Witiko und Bertha, oder Anna Plochl und Erzherzog Johann. Unendlich langsam! Obwohl beim Betreten des Wohnhauses die Beiden feststellen, darin gemeinsam zu wohnen und Claude seine Begleiterin für den nächsten Tag zum Frühstück einlädt, dauert es noch einige Dutzend Seiten, bis…
Stella, genannt Lia hat ein bewegtes Leben hinter sich und die aufkeimende Liebe der Beiden zueinander scheint ihre Vergangenheit zu überdecken. Schüchtern und zurückhaltend wie sie noch sind, schreiben sie sich ihre Vergangenheiten gegenseitig. Das hat immerhin den Vorteil, man kann nicht unterbrochen werden, wie es bei einem Gespräch, einer „Beichte“ zwangsläufig der Fall wäre. Stella erfährt dabei, in welch geordneten Verhältnissen Claude aufgewachsen ist, erfährt von seiner kurzen Jugendehe, seinem Studium und vor allem, wie dieses sein weiteres Leben und Denken beeinflussten. Es ist aufschlussreich, dass vom Autor auch ein Band mit Essays vorliegt, in denen er zu Gedenktagen von wichtigen Menschen – vor allem Künstlern – Stellung bezieht. Es bleibt nicht aus und ist aufgrund der Fülle des Materials verständlich, dass nun Claude in seinen Gesprächen – manchmal wäre man versucht von Belehrungen zu sprechen - mit Stella diese Erkenntnisse einfließen lässt. Lieber Martin, da wäre weniger oft mehr gewesen. Da stellt der Autor diese arme gequälte junge Frau auf eine arge Probe, wenn er seine akademischen Erkenntnisse zur Kultur vergangener Zeiten ausbreitet und Beziehungen und Verbindungen zur Gegenwart oder auch zur Vergangenheit von Stella herstellt. Ich vermeide bewusst den Ausdruck konstruiert, aber es ist fast ein Bauplan zu erkennen, wie die unbedarfte Stella, die einen Aushilfsjob in einem Supermarkt bekommt, in die Welt der „Kulturwissenschaft“ eingeführt werden soll. Claude nimmt seine Beziehungen zur Hilfe, um Stella auch zusätzlich eine Beschäftigung in einem Laden einer befreundeten Buchhändlerin zu verschaffen. Seine gute Fee, eine ältere Dame, die sich sehr kosmopolitisch gibt und bei seinen berufsbedingten Abwesenheiten seine Wohnung betreut, nimmt sich ebenfalls Stellas an. Anscheinend ist der gesamte Ort bestrebt den liebenswerten, etwas schrulligen Professor Gutensohn zu „versorgen“. Die Chefin des Supermarktes, die auch im Gartenbauverein des Anfangs tätig ist, veranstaltet Gartenfeste, mehr oder weniger zwanglose Zusammenkünfte in der Schrebergartenanlage, eigentlich alles, um gewollt oder ungewollt Stella und Claude zusammen zu bringen. Damit ist das „Hauptpersonal“ des Romans umrissen, die Nebenpersonen, die noch auftauchen spielen keine Rolle, außer dass eine Fabienne krampfhaft versucht den Claude für sich zu gewinnen und dabei ihre akademische Bildung gegenüber der Ladenaushilfskraft ausspielt. Doch, wie es sich für einen unmodernen Roman gehört, Claude meistert auch diese Anfechtungen souverän. Und trotzdem dauert es bis zur Seite – nein, die verrate ich nicht, sonst wird womöglich gleich dort aufgeschlagen – zur ersten Annäherung die fast in einer Katastrophe endet. Begründet durch die Vorgeschichte(n) Stellas, für die Claude volles Verständnis aufbringt und weiter …
Es dauert danach nur mehr knapp dreißig Seiten, bis die Beiden dann endlich (!) auch ihre so ersehnte körperliche Erfüllung finden, auch dabei bleibt der Roman angenehm unmodern!
Der Rezensent hat bereits einen Band mit mehreren Novellen des Autors gelesen. Es ist auffallend, wie sich eine Linie durch alle belletristischen Texte Martins zieht: Eine Hilfe zum Selbstaufstehen nach unendlich vielen Abstürzen, es gibt immer eine Hand, die entweder zugreift oder angeboten wird. Und alle, von denen zu lesen war, haben es geschafft. Die heile Schweizer Welt? Oder ein Versuch zu zeigen, was Liebe möglich macht?
Das mögen die Leser des Romans (und der übrigen Werke des Autors) selbst beurteilen.
Modern sind sie nicht, nicht einmal postmodern! Aber lesenswert immer. Auch um ein wenig mehr vom unbekannten Wesen, dem Schweizer, kennen zu lernen und deren Spezialausdrücke in der Alltagssprache zu erfahren. Denn was ein „erst vor wenigen Woche hierher zügeln“ bedeutet, geht aus dem Text zwar klar hervor, wäre aber für einen durchschnittlichen österreichischen Leser eher schwer verständlich. Ein „kurzes Znacht“ oder ein „Zmorgen bei mir“ erläutern sich von selbst, aber sie sind nette schweizerische Eigenheiten, die Gott sei Dank vom Hamburger Verlag nicht heraus lektoriert wurden.
Von Gestern?
von Martin StankowskiRezension von Hans Bäck
Essays zu Gedenktagen und kulturellen Fragen
tredition Verlag Hamburg
ISBN 978-3-347-19317-8
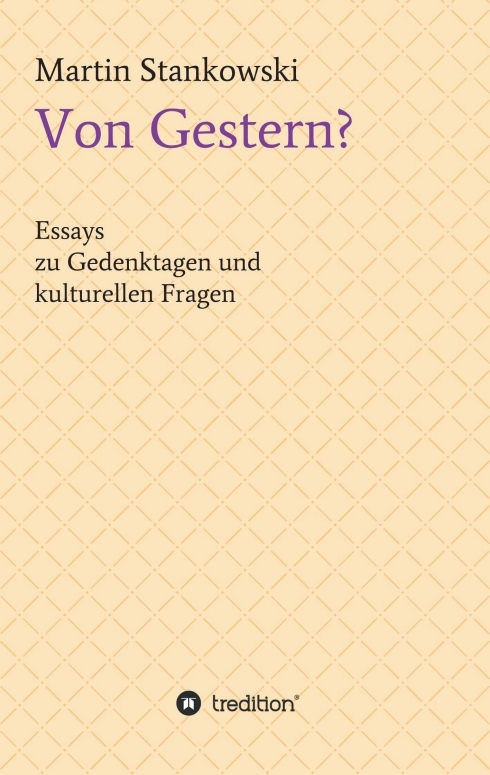 Es ist immer wieder faszinierend festzustellen, wie verdiente Schriftsteller über andere Kollegen schreiben, speziell wenn es sich um solche handelt, die schon lange oder zumindest länger nicht mehr unter uns sind. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, wie wird ausgewählt? Nach dem persönlichen Empfinden des Autors, oder gibt ihm jemand vor, „darüber“ zu schreiben? Jedenfalls die Auswahl von Gedenktagen und den dazugehörigen Essays könnte schon eine spannende Geschichte ergeben. Darüber schweigt aber der Autor in seinem vorliegenden Band mit „Beiträgen zu 25 Gedenktagen“. Für den Rezensenten etwas befremdend erscheint, dass Theodor Fontane mit vier Beiträgen, Gottfried Keller auch mit zwei gewürdigt wird, dagegen aber viele andere gar nicht aufscheinen. Wie gesagt, die Auswahl der zu würdigenden Personen wird immer fragwürdig, d. h. im Wortsinn der Rückfrage würdig, bleiben. Gut, soweit zur Einleitung. Doch, nein, ich kann den Autor noch nicht entlassen. Pearl S. Buck, Emily Dickinson, und einige andere haben bei Durchsicht der Aufgelisteten doch ein wenig Verwunderung ausgelöst. Interessant wäre zu erfahren, was den Autor bewogen hat als Literat beispielsweise zu Maximilian I. oder J. J. Winckelmann Stellung zu beziehen. Wobei ich wieder bei der Frage der Auswahl bin. Doch bleibe ich kurz bei Winckelmann hängen. Dass die Aussage der „stillen Einfalt und edlen Größe“ so ohne Kommentar übernommen und weiter gegeben wird, hat bei mir Befremden ausgelöst. Immerhin wissen wir ja aus den zahlreichen überkommen und erhaltenen Zeugnissen der „alten“ Griechen, dass diese ein Volk von Betrügern, Schändern, Vertragsbrechern und vieles mehr waren. Und sie machten ja nicht einmal ein Geheimnis aus ihren Schandtaten – sie breiteten diese in aller Öffentlichkeit aus, waren noch stolz darauf.
Es ist immer wieder faszinierend festzustellen, wie verdiente Schriftsteller über andere Kollegen schreiben, speziell wenn es sich um solche handelt, die schon lange oder zumindest länger nicht mehr unter uns sind. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, wie wird ausgewählt? Nach dem persönlichen Empfinden des Autors, oder gibt ihm jemand vor, „darüber“ zu schreiben? Jedenfalls die Auswahl von Gedenktagen und den dazugehörigen Essays könnte schon eine spannende Geschichte ergeben. Darüber schweigt aber der Autor in seinem vorliegenden Band mit „Beiträgen zu 25 Gedenktagen“. Für den Rezensenten etwas befremdend erscheint, dass Theodor Fontane mit vier Beiträgen, Gottfried Keller auch mit zwei gewürdigt wird, dagegen aber viele andere gar nicht aufscheinen. Wie gesagt, die Auswahl der zu würdigenden Personen wird immer fragwürdig, d. h. im Wortsinn der Rückfrage würdig, bleiben. Gut, soweit zur Einleitung. Doch, nein, ich kann den Autor noch nicht entlassen. Pearl S. Buck, Emily Dickinson, und einige andere haben bei Durchsicht der Aufgelisteten doch ein wenig Verwunderung ausgelöst. Interessant wäre zu erfahren, was den Autor bewogen hat als Literat beispielsweise zu Maximilian I. oder J. J. Winckelmann Stellung zu beziehen. Wobei ich wieder bei der Frage der Auswahl bin. Doch bleibe ich kurz bei Winckelmann hängen. Dass die Aussage der „stillen Einfalt und edlen Größe“ so ohne Kommentar übernommen und weiter gegeben wird, hat bei mir Befremden ausgelöst. Immerhin wissen wir ja aus den zahlreichen überkommen und erhaltenen Zeugnissen der „alten“ Griechen, dass diese ein Volk von Betrügern, Schändern, Vertragsbrechern und vieles mehr waren. Und sie machten ja nicht einmal ein Geheimnis aus ihren Schandtaten – sie breiteten diese in aller Öffentlichkeit aus, waren noch stolz darauf.
Das wäre ein wenig ein sachlicher Einwand gegen diese Beiträge. Zu bewundern ist die Sorgfalt mit der Stankowski diese aufbereitet hat. Wahrscheinlich der doch langen Fahrzeit zwischen der Ostschweiz und Oberösterreich zu danken. Da kann man – wenn die WLAN-Verbindung in den Zügen der ÖBB funktioniert – tatsächlich in Ruhe arbeiten. Jedenfalls, die Genauigkeit der Recherche ist beeindruckend.
Es ist die Eigenart des Autors, sehr lange Sätze zu verwenden, da wäre „weniger sicher mehr gewesen“ und kann m. E. nicht als Schweizer Eigenart abgetan werden. Es ist oftmals anstrengend diese Sätze so nachzuverfolgen, dass die Sinnhaftigkeit gewahrt bleibt (Seite 180, Seite 254 aber auch sonst fast überall).
Was bleibt? Das Verwundern, dass beispielsweise ein Hermann Burger nicht vorkommt, obwohl Schweizer – wie der Autor – und ein Sprachkünstler sondergleichen. Auch fehlt mir jeder Hinweis auf die doch fulminante literarische Entwicklung in den 1960 - 1970er Jahren in Graz, mit Wolfgang Bauer, Alfred Kolleritsch, dem beginnenden Gerhard Roth und all den vielen anderen, die auf die Literatur der späteren Jahrgänge doch mehr Auswirkungen hatten als eine E. Bronte.
Ja, die Auswahl. Natürlich, an einem Robert Musil und einem Peter Rosegger kommt ein Schweizer Essayist auch nicht vorbei. Einen österreichischen Leser stört allerdings ein Begriff wie auf Seite 212 wenn davon die Rede ist, dass Rosegger seine SCHREIBE als deutsch verstand. Diesen Begriff, diesen Ausdruck, den hat Rosegger niemals verwendet.
Ergänzt wird der Band noch durch vier „Essays zur Kultur“. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, den der Autor hier erhebt. Gleich als ersten Beitrag legt er ein Vortragsmanuskript vor, das sich mit nichts Geringerem als „Gelesen. Auf Deutsch. Über den Frieden.“ beschäftigt. Nun, dies in einem eineinhalbstündigen Vortrag abzuhandeln ist schon eine gewisse Herausforderung, wobei die (schriftlichen) Unterlagen dazu natürlich bei weitem nicht alles abdecken, was womöglich im gesprochenen Text vorhanden wäre. Diesem Thema, aber auch diesem Beitrag hätte eine redaktionelle Bearbeitung (Straffung) gut getan.
Die ewige Frage „wann, wen küsst die Muse?“ wird umfangreich, gespickt mit Beispielen aus vielen Bereichen der Künste, besprochen. Besonders freut sich der Rezensent darüber, dass in einer der Fußnoten sogar das heimische Reibeisen (Ausgabe 2014) angesprochen wurde: „ist Kunst auch Arbeit?“ No na, möchte man antworten. Wenn man daran denkt, wieviel Arbeit ein Autor erst hat, wenn das Manuskript „fertig“ ist! Wir alle wissen, was da erst an Arbeit auf uns zukommt.
Der abschließende Beitrag „Wenn selbst das Moderne bereits alt ist“ geht in unnachahmlicher Weise auf die Fragestellungen der professionellen Betrachter ein: Was ist “modern“ was ist postmodern“ (die architektonischen Leistungen der Post???). Die sich ständig beschleunigende Aufeinanderfolge, die Abfolge der wechselnden Nacheinander-Modernen (Seite 322) können belustigen, verärgern, sprachlos machen oder im besten Fall dazu verführen, auch das Allerneueste der Neuesten Bücher zu lesen. Und sich selbst ein Urteil bilden, und nicht den vorgekauten Rezensenten – Texten glauben (diesen eingeschlossen).
Einträge 11 bis 15 von 64 | Weitere ->
