Rezensionen und Lesetipps
An dieser Stelle weisen wir Sie auf Bücher hin, die auf verschiedensten Wegen zu uns gefunden haben.
Vielleicht können wir mit unseren Besprechungen Ihr Interesse wecken, sie ebenfalls zu lesen.
Rezensionen eingrenzen
Unsentimentale Geographie
von Hans BäckRezension von E X T E R N
SoralPRO Verlag, Graz
ISBN 978-3-903223-64-6
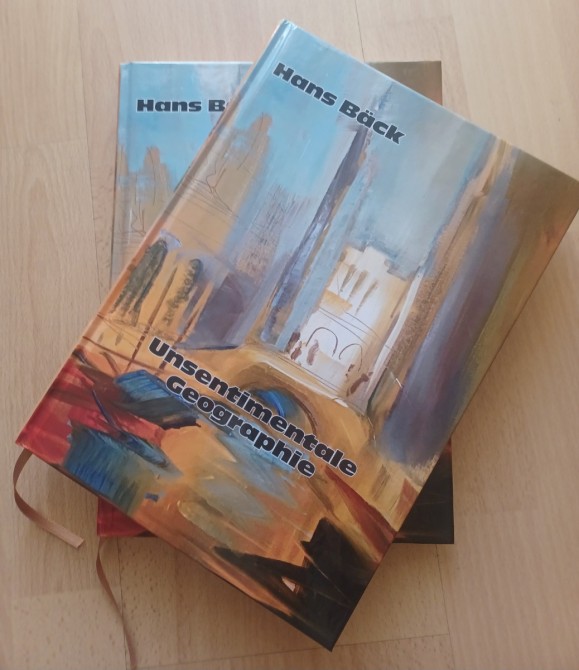 Ich habe mich nun intensiv mit dem Buch beschäftigt und einiges hat mich sehr beeindruckt. Es ist meiner Meinung nach eine gelungene Darstellung wichtiger Ereignisse aus dem Leben des Schriftstellers in den verschiedensten geographischen Standpunkten der Erde. Eben eine „unsentimentale Geographie”. Wenn man aber genauer und sehr aufmerksam liest, findet man im Gegenteil sehr viel Sentiment, die von jedem Leser anders empfunden werden wird. Es wird Leser geben, die zuerst mit einem Schmunzeln und dann sehr genau, die persönliche Entwicklung des Jugendlichen während seiner ersten Abenteuer im selbstständigen Leben, in seinen Berufskarrieren, im Familienleben bis zum reifen Schriftsteller, der auch kritisch sein kann, mit verfolgen werden. Andere Leser werden von seiner Naturliebe – vor Allem die Berge – begeistert sein und viele werden Orte wiedererkennen, wo auch sie schon waren oder in ihnen wird die Neugier geweckt, ebenfalls auf Entdeckungsreise zu gehen. Auch die Leser, die sich für Geschichte und geopolitische Zusammenhänge und Kultur interessieren werden nicht zu kurz kommen. Der Schriftsteller beschreibt in sehr klaren einfachen Worten, wie oft unter politischen Weltentscheidungen Menschen unter nicht von ihnen gewollten Auseinandersetzungen Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte entsetzlich leiden mussten. Dies auch oft in unserer Nähe. Ich war meinem Schicksal dankbar, dass ich in Westeuropa im Frieden, zwar in einfachen Verhältnissen, aber ohne Existenzängste aufwachsen und leben konnte. Obwohl ich mich gerne mit Geschichte befasse, ist mir erst in den letzten 10 Jahren wirklich bewusst geworden, wie wenig wirkliche Informationen man als normaler Mensch in den Medien erhält. Ich hatte es geahnt, aber der wirkliche Anstoß, mich mit unserer wahren Geschichte zu beschäftigen, gaben mir die Biographien von Julius Kugy und Rudolf Baumbach. Ich sollte die Geschichte von unserem deutschen Verein in Trieste zusammenstellen und viele Fragen brachten mich dazu, gerade diese beiden Persönlichkeiten zu betrachten. Nun zu meiner großen Überraschung und auch Freude sind mir Rudolf Baumbach und Julius Kugy in diesem Buch begegnet und auch eine sehr ergreifende Beschreibung vom Karst und Triest, die Stadt, die seit 40 Jahren meine Wahlheimat ist. Viele Orte und Begebenheiten in dem Buch sind mir nicht bekannt. Aber sie haben mich neugierig gemacht. Andere Orte, die ich kenne, sind so genau geschildert worden, dass ich der Überzeugung bin, dass man sich keinen besseren Ratgeber für eine individuelle Entdeckungsreise wünschen kann.
Ich habe mich nun intensiv mit dem Buch beschäftigt und einiges hat mich sehr beeindruckt. Es ist meiner Meinung nach eine gelungene Darstellung wichtiger Ereignisse aus dem Leben des Schriftstellers in den verschiedensten geographischen Standpunkten der Erde. Eben eine „unsentimentale Geographie”. Wenn man aber genauer und sehr aufmerksam liest, findet man im Gegenteil sehr viel Sentiment, die von jedem Leser anders empfunden werden wird. Es wird Leser geben, die zuerst mit einem Schmunzeln und dann sehr genau, die persönliche Entwicklung des Jugendlichen während seiner ersten Abenteuer im selbstständigen Leben, in seinen Berufskarrieren, im Familienleben bis zum reifen Schriftsteller, der auch kritisch sein kann, mit verfolgen werden. Andere Leser werden von seiner Naturliebe – vor Allem die Berge – begeistert sein und viele werden Orte wiedererkennen, wo auch sie schon waren oder in ihnen wird die Neugier geweckt, ebenfalls auf Entdeckungsreise zu gehen. Auch die Leser, die sich für Geschichte und geopolitische Zusammenhänge und Kultur interessieren werden nicht zu kurz kommen. Der Schriftsteller beschreibt in sehr klaren einfachen Worten, wie oft unter politischen Weltentscheidungen Menschen unter nicht von ihnen gewollten Auseinandersetzungen Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte entsetzlich leiden mussten. Dies auch oft in unserer Nähe. Ich war meinem Schicksal dankbar, dass ich in Westeuropa im Frieden, zwar in einfachen Verhältnissen, aber ohne Existenzängste aufwachsen und leben konnte. Obwohl ich mich gerne mit Geschichte befasse, ist mir erst in den letzten 10 Jahren wirklich bewusst geworden, wie wenig wirkliche Informationen man als normaler Mensch in den Medien erhält. Ich hatte es geahnt, aber der wirkliche Anstoß, mich mit unserer wahren Geschichte zu beschäftigen, gaben mir die Biographien von Julius Kugy und Rudolf Baumbach. Ich sollte die Geschichte von unserem deutschen Verein in Trieste zusammenstellen und viele Fragen brachten mich dazu, gerade diese beiden Persönlichkeiten zu betrachten. Nun zu meiner großen Überraschung und auch Freude sind mir Rudolf Baumbach und Julius Kugy in diesem Buch begegnet und auch eine sehr ergreifende Beschreibung vom Karst und Triest, die Stadt, die seit 40 Jahren meine Wahlheimat ist. Viele Orte und Begebenheiten in dem Buch sind mir nicht bekannt. Aber sie haben mich neugierig gemacht. Andere Orte, die ich kenne, sind so genau geschildert worden, dass ich der Überzeugung bin, dass man sich keinen besseren Ratgeber für eine individuelle Entdeckungsreise wünschen kann.
Ilona Grosser, Trieste
Sternengeflüster
von Friederike KrassnigRezension von Hans Bäck
Der Wortbruch
Ja, ich breche mein mir selbst gegebenes Wort!
Ich nahm mir vor, keine Rezensionen mehr zu schreiben. Sie sind mit viel Arbeit verbunden: Das Buch ist zu lesen, die Anmerkungen zu bearbeiten, die Besprechung einmal vor-formulieren, dann ausarbeiten und fertigstellen usw. Jeder, der Rezensionen schrieb, kennt das Prozedere.
Und ich gebe zu, ich wurde älter, behäbiger (um nicht zu sagen fauler) und so fasste ich den Entschluss keine Rezensionen mehr zu schreiben. Viele Leser werden wahrscheinlich sagen: Gott sei Dank, hört er auf.
Doch dann gibt es diese Ereignisse, welche die besten Vorsätze in Nichts zusammenfallen lassen. Da kommt ein Buch daher, ein Gedichtband einer Dichterin, die mit 92 Lebensjahren noch nicht alt und behäbig geworden ist, sondern weiterschreibt, trotz körperlicher Beeinträchtigung – denn wer ist mit einer Makuladegeneration noch in der Lage einen Gedichtband mit fast 90 Seiten herauszubringen?!
Da hat mich die Friederike Krassnig doch tatsächlich am „linken Fuß“ erwischt, schreibt weiterhin Gedichte und veröffentlicht noch einen weiteren Band, der sich nahtlos in die lange Reihe der von ihr Herausgegebenen einordnet!
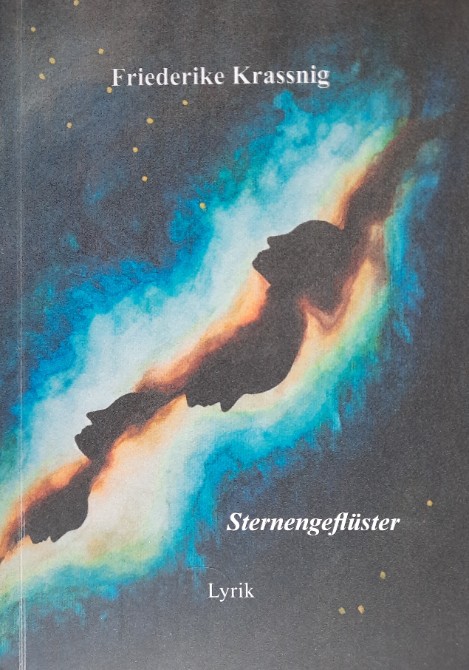 „Sternengeflüster“ nun ja möchte man meinen, das ist wieder so eine Lyrik abseits des Weltgeschehens, wo die Welt in Ordnung beschrieben wird oder dieser nachgetrauert wird, da werden die Blümchen sprießen, die Sterne eben von Vergangenem flüstern. Alle jene, die von der Literatur Engagement erwarten, Stellungnahmen einfordern, werden die Nase rümpfen, einen Seufzer ausstoßen und … was eigentlich? Zur Tagesordnung übergehen?
„Sternengeflüster“ nun ja möchte man meinen, das ist wieder so eine Lyrik abseits des Weltgeschehens, wo die Welt in Ordnung beschrieben wird oder dieser nachgetrauert wird, da werden die Blümchen sprießen, die Sterne eben von Vergangenem flüstern. Alle jene, die von der Literatur Engagement erwarten, Stellungnahmen einfordern, werden die Nase rümpfen, einen Seufzer ausstoßen und … was eigentlich? Zur Tagesordnung übergehen?
Nach der Lektüre von Gedichten der Friederike Krassnig so einfach zur Tagsordnung übergehen, so als ob man nichts Besonderes gelesen hätte? Blümchen- Jahreszeitenlyrik, ablegen, weglegen.
Das geht nicht! Krassnig ist anders! Ja, nach so vielen Jahrzehnten des Schreibens, sie hat noch immer was zu sagen!
Es fasziniert mich seit eben Jahrzehnten, was sie schreibt, was sie uns zu Lesen gibt!
Ich gebe zu, Lyrik lese ich gerne, von unterschiedlichsten Autoren, auch aus anderen Sprachgegenden. Ich habe in meinen Bücherschränken viele Regale mit Lyrik vollgestopft. Natürlich die klassischen Werke, die „Großen“ der Literatur“ aber die vielen Unermüdlichen, welche die wahren Werte der Literatur hochhalten (ohne dabei auf Preise und Auszeichnungen zu schielen) und weitgehend unbedankt, lärmarm oder gar lärmlos, wunderbare Lyrik schreiben. Welche Mühe, welche Sorgfalt dahintersteckt, das erahnt der Leser nicht, das ist das Geheimnis der Dichterinnen und Dichter. Das ist das Geheimnis der Friederike Krassnig. Auch in ihrem neuesten Gedichtband „Sternengeflüster“. Ein wenig verrät sie uns, was sie bewegt Lyrik zu schreiben:
„Gedichte sind Gedankengut,
auch ohne Jamben und Trochäen,
der Worte ausgeschlüpfte Brut
als Traummusik nur zu verstehen“
(Seite 31)
Die Einführung, das Geleitwort von Insa Segebade, unserer langjährigen Kollegin des Europa-Literaturkreises Kapfenberg enthält den bezaubernden Satz: … wie ein unwiderstehlicher Sog, in dem man ewig schweben und schwelgen möchte…
Ja, liebe Friederike Krasssnig, Insa Segebade schreibt weiter: „Ihre Poesie macht das Leben leichter! Es ist die Sprache, die Bilder vor dem inneren Auge entstehen lässt!“
In dieser lärmenden Welt ist das unendlich viel!
Hans Bäck, Dezember 2023
Tortilla Flat
von John SteinbeckRezension von Karl Forcher
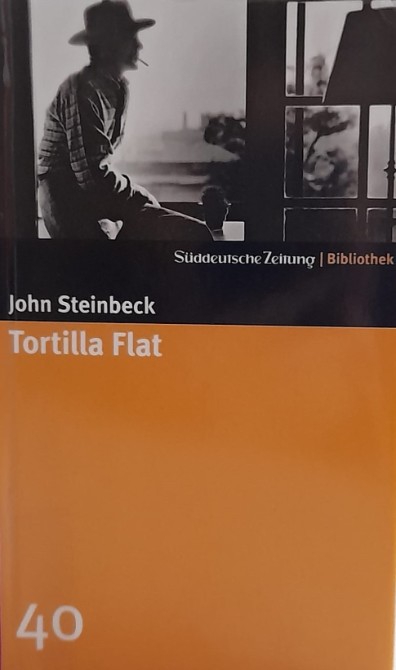 Ein Schelmenroman! Und Steinbeck spielt ganz bewusst auch in der Form damit. Alle Kapitel sind mit einer kurzen Zusammenfassung im Titel versehen, wie es die Tradition ist bei den großen Schelmenromanen der Neuzeit.
Ein Schelmenroman! Und Steinbeck spielt ganz bewusst auch in der Form damit. Alle Kapitel sind mit einer kurzen Zusammenfassung im Titel versehen, wie es die Tradition ist bei den großen Schelmenromanen der Neuzeit.
Und doch bricht der Autor zu neuen Zeiten auf, damals vor fast 90 Jahren. 1935 erschien dieser Roman, diese Erzählung, dieses Sammelsurium von Geschichten und Anekdoten. Eine andere Zeit, schon modern und doch, eigentlich nicht mehr vorstellbar.
Ich denke an: Geld! Der Pirat, er schlägt Knüppelholz im Wald oberhalb Montereys. Täglich. Und verkauft es in der Stadt um einen Vierteldollar. Ein Vierteldollar! Was uns heute eine lächerliche Summe, es war zu dieser Zeit ein Wert.
Eine Gallone Wein kostet ungefähr einen Dollar. Ich schlug nach, weiß nun, eine Gallone sind ungefähr 3,8 Liter. Und der Preis, nur ungefähr? Nun, Steinbecks und durchaus auch des Lesers Helden, sie trinken viel, sie prügeln sich, sie lieben im Vorübergehen. Aber den Wein, den stehlen sie meist.
Ja, sie sind Diebe, unsere Helden. Tunichtgut, ein alter Ausdruck. Aber falsch. Sie gehen keiner geregelten Lohnarbeit nach. Aber dass sie nichts Gutes tun, nein, das stimmt so nicht.
Gewiss, sie stehlen, wie schon erwähnt, Wein. Sie melken fremde Ziegen. Sie rupfen und verspeisen die Hühnchen der Nachbarin. Aber edel ist oft ihr Sinnen, wahrhaftig ihre Freundschaft. Wie die Tafelrunde, Steinbeck mag sie im Hinterkopf gehabt haben.
Danny, dass ist Artus. Mittellos vom Krieg heimgekehrt, wird er nach dem Tod des Großvaters plötzlich zum Besitzer zweier Häuschen in Tortilla Flat oberhalb Montereys. Er schart seine Freunde um sich, im größeren Haus, nachdem das kleinere bald in Flammen aufgeht.
Wie in der Artussage tritt Danny in den Hintergrund, werden in den Kapiteln die Abenteuer der „Ritter“ erzählt. Vom klugen Pilon, der alles weiß. Von Jesus Maria Corcoran, von Pablo, vom Piraten mit seinen fünf Hunden, von Big Joe Portagee.
Dazu eine Vielzahl an Männern und Frauen, die Steinbeck einmal oder öfters den Weg kreuzen oder in die Erzählungen unserer Freunde auftauchen lässt.
Lest es, dieses aus der Zeit gefallene Dokument, dieses schräge Dokument über ein Proletariat, wie es in der großen Depression, lebte, liebte, soff und philosophierte. Zumindest im Tortilla Flat John Steinbecks.
Kurzgeschichten
von Michel TapiònRezension von Hans Bäck
Verlag Buchschmiede
ISBN 978-3-99139-983-4
Dr. MARTIN GOLLWITZ Gymnasialprofessor in der deutschen Provinz hat ein Theaterstück über ein Thema der Klassik geschrieben: Die Geschichten rund um den historischen Raub der Sabinerinnen. Der Direktor einer Wanderbühne bemüht sich das Stück aufzuführen. Wer das Stück nicht kennt, derzeit wird es in Wien im Akademietheater aufgeführt.
Der Herr Professor hatte ein Stück geschrieben, er fühlte sich berufen, der deutschen Literatur ein weiteres klassisches Schwergewicht hinzufügen.
Nur das überragende Improvisationstalent des Direktors der „Schmierenbühne“ rettet das Stück, das Theater und letztlich auch den Autor.
Warum beginne ich eine Rezension mit einem Hinweis auf ein Theaterstück aus dem Jahre 1883?
Weil: es wiederholt sich alles! Oder: Alles schon da gewesen!
Ein Autor unserer Tage schreibt „mit seinem Herzblut“ (auch das kommt im Raub der Sabinerinnen vor!) einen umfangreichen Roman. Denn: darunter tut man es nicht, darunter, das ist ja womöglich keine Literatur! Also kommt nach vielen Geburtswehen das große Werk endlich auf die Welt. Doch diese hat gerade auch auf diesen Roman nicht gewartet. Enttäuschung beim Autor?
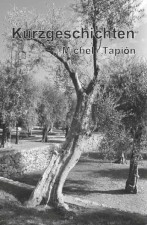 Jedenfalls, er setzt sich hin und schreibt ein schmales Bändchen und nennt es „Kurzgeschichten“. Da ist nix mehr vom Herzblut drinnen, da werden keine weltbewegenden Probleme und Schicksale aufgeblättert. Da zeigt der Autor, was er kann!
Jedenfalls, er setzt sich hin und schreibt ein schmales Bändchen und nennt es „Kurzgeschichten“. Da ist nix mehr vom Herzblut drinnen, da werden keine weltbewegenden Probleme und Schicksale aufgeblättert. Da zeigt der Autor, was er kann!
Ein wenig wie der Dr. Gollwitz in dem Stück von Schönthan, der ein klassisches Drama schaffen wollte und eine köstliche Komödie dabei herauskam.
Fazit: Es muss nicht das große literarische Werk sein, mit dem das Publikum auf einen Autor aufmerksam wird. Es genügt eine Sammlung von 15 Kurz- und Kürzestgeschichten um das Können und die Begabung eines Autors zu erkennen. Vielleicht sind diese Kurzgeschichten jener Erfolg, den der Autor (und nicht nur er) mit seiner Veröffentlichung erhoffte.
Lieber Michel Tapion! Bleib bei dieser kleinen Form, das kannst Du, da hast Du Stärken, die ich Dir nach der verunglückten Anna-Sophie gar nicht mehr zugetraut hatte.
Lass die Finger von den „großen Werken“, mach das, was du kannst.
Und Kurzgeschichten schreiben, das kannst Du!
In aller Freundschaft
Hans Bäck
Die Geschichte vom Esel der sprechen konnte
von Michael ScharangRezension von Hans Bäck
Roman
Czernin, ISBN 978-3-7076-0791-8
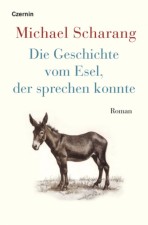 Sind wir ehrlich, das ist ein Märchen. Auch wenn es nicht so wie ein Märchen beginnt: „Es war einmal, vor langer Zeit …“ und auch nicht endet wie ein Märchen, denn der letzte Satz lautet nicht: „und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch.“
Sind wir ehrlich, das ist ein Märchen. Auch wenn es nicht so wie ein Märchen beginnt: „Es war einmal, vor langer Zeit …“ und auch nicht endet wie ein Märchen, denn der letzte Satz lautet nicht: „und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch.“
Und doch ist es ein Märchen. Ein wunderschönes sogar! Ein kleiner Junge rettet einen verwahrlosten Esel vor dem Verhungern und Erfrieren, und das alles in den letzten Kriegstagen. Die letzten Bomben werden von den Alliierten über der Stadt abgeworfen, die Großmutter und der kleine Moritz kommen mit dem Esel gerade noch davon. Der Esel wird in der Holzhütte der Großmutter einquartiert und weil er vom kleinen Moritz gerettet wurde, können ab sofort der Junge und der Esel miteinander kommunizieren – sprechen. Womit wir beim Titel des Buches wären.
Wir erleben die letzten Kriegstage in der Heimatstadt des Autors, Kapfenberg wird auch nicht verborgen oder hinter einem Pseudonym versteckt. Wie überhaupt viele Namen im Laufe der Geschichte – oder des Märchens – genannt werden. Lokalkolorit? Oder bewusste Hinführung? Es wäre nicht Michael Scharang, wenn die Hinweise auf die Vergangenheit seiner Vaterstadt fehlen würden. Die Erinnerung an den 12. Februar 1934 fällt genau mit dem Bombenabwurf 11 Jahre später zusammen. Der kleine Esel und der Junge sind ab sofort unzertrennlich, teilen Freude und kindliche Schmerzen miteinander, sind unterwegs in den Wäldern rund um die Stadt, kommen zum Wallfahrtsort oberhalb der Stadt, besuchen den Wunderbaum, die zwei Wirtshäuser, die Bauernhöfe. Was in anderen Erzählungen aus dieser Zeit ein ganz wesentliches Element der Begebenheiten ist, das „Hamstern“, wird in dieser Form von Scharang sehr abgemildert dargestellt. Sehr wohl ist die „Zurückhaltung“ der Bauern bei der Hilfe und Unterstützung der Stadtbevölkerung, der Fabriksarbeiter, ein Thema. Märchenhaft ist die Schilderung, wenn die Großmutter des Moritz bei der Zubereitung von faschierten Laberln in einem der Wirtshäuser im Wallfahrtsort behilflich ist. Der allgemeine Mangel in dieser Zeit wird (bewusst?) ausgeblendet. In der offiziellen Chronik der Stadt Kapfenberg steht für diese Zeit eine Zuteilung von etwa 1500 Kalorien pro Tag für „Normalverbraucher“.
Schwierigkeiten hatte der Vater des Moritz im Werk: Im Zuge von verdächtigter Sabotage an Panzergetrieben, der Zuwendung von Brot an die französischen Zwangsarbeiter, kam es zu den letzten Zuckungen des NS Regimes, um noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Dann der erlösende Tag „Der Krieg ist aus!“ und die „wunderschöne Zeit“ der russischen, nein der sowjetischen Besatzung beginnt. Da wird es nicht viele Kapfenberger geben, die bei diesen Passagen dem Autor zustimmen. Es gibt auch andere Erinnerungen an die paar Monate der sowjetischen Besatzungszeit, und nicht nur Zeltfeste, Kinderspiele, Pferde- und Fahrzeugverleih an die Bevölkerung. Da gibt es einige, welche da andere Erinnerungen haben. Da es sich aber um ein Märchen handelt, blendet der Autor diese Ereignisse aus. Die „Russen“ sind die herzlich willkommenen Befreier und sie sorgen für Ernährung der Bevölkerung, Sicherheit (auch der Frauen, die unterwegs sein müssen), Ordnung und Verwaltung. Auch hier beschreibt die Chronik der Stadt eine andere Situation. Das Werk, die Fabrik selbst, wird zu gezielter Demontage der Einrichtungen und als Wiedergutmachung erfolgt der Transport in die UdSSR. Ein Wiederaufbau ist unter dieser Besatzung nicht zu erwarten.
Altersmild schildert Scharang die urplötzliche Wandlung von SS Führern zu sozialistischen Vizebürgermeistern. Das hatte er in früheren Werken nicht so harmlos geschildert. Aber, ich denke der revolutionäre Geist früherer Jahre ruht sich aus.
Ausführlich wird geschildert wie der Aufbruch nach den Jahren der Diktatur, des Krieges erfolgte. Die wichtigsten handelnden Personen werden namentlich genannt und in ihrer Bedeutung für die Stadt ausführlich geschildert. Ob es der Architekt Ferdinand Schuster, der erste Leiter der Musikschule und spätere Landesmusikdirektor Marckhl waren, sie prägten nicht nur Kapfenberg und damit den Werdegang des kleinen Moritz und seines Begleiters, dem Esel. Das schildert Scharang sehr bildhaft und ausführlich. Verständlich, seine spätere Lebenshaltung wurde in dieser Zeit und auch von diesen Menschen geprägt. Der Autor und der Rezensent saßen in der gemeinsamen Volksschule, zur Hälfte von einem Bombentreffer zerstört, erlebten wie die Lehrer damals in der Lage waren, eine Klasse mit 48 Schülern zu unterrichten. Wir erlebten auch, wie die tägliche „Ausspeisung“ - eine warme Mahlzeit von der britischen Besatzungsmacht organisiert – für viele der 48 lebensnotwendig war! Dass dies nicht mehr von der sowjetischen Armee kam, das verschweigt Scharang. Betroffene, nein Leidtragende Überlebende der jugoslawischen Kriegsgefangenenlager werden seine milde Beurteilung des Lagerlebens in Jugoslawien nicht teilen. Sterntal, und die anderen Lager waren zu fürchterlich, um sie zu vergessen. Ganz zu schweigen von jenen, die auf Goli Otok inhaftiert waren. Das waren überwiegend jene jugoslawischen Kommunisten, welche den Bruch Titos mit Stalin nicht verstehen wollten. Der Rezensent schreibt darüber in einem eigenen Buch ausführlich. Daher nur der Hinweis, dass Scharang leider einseitig berichtet. Das ist bei der Fülle des Geschilderten schade. Denn, wenn auch der Sozialismus kläglich gescheitert war, Karl Marx hatte Recht behalten: Der wichtigste Produktionsfaktor, der Mensch, hat sich selbstständig gemacht und kein Unternehmer kann sicher sein, dass seine Mitarbeiter am nächsten Tag nicht bei der Konkurrenz anheuern. Auch darüber schrieb der Rezensent in einem sep. Buch!
Doch zurück zum Märchen vom Esel, der sprechen konnte.
Das Märchen entwickelt sich weiter, der sowjetische Offizier, der Kapfenberg so vorbildlich in der Besatzungszeit betreut, verwaltet, versorgt hatte, wurde Botschafter der UdSSR in Österreich, genau zu der Zeit, als Moritz nach der Matura nach Wien ging, um zu studieren. Sogar für den Esel war gesorgt, in der Residenz des Botschafters konnte ein Stall, eine Behausung gefunden werden.
Das weitere Leben, vor allem die Familiengründung des Moritz, seine berufliche Entwicklung, die ununterbrochen vom Esel und dessen Betreuung begleitet war, können wir nun miterleben. Viele der Bücher Scharangs werden in der Entstehung geschildert und das alles mit Hilfe des sagenhaften, nein, des märchenhaften Esels. Bis zu den Enkelkindern begleitet der Esel die Familie! Wie begründet er das? „Sechzig Jahre, fuhr Moritz fort. Esel werden normalerweise nicht so alt. Das ist so, war die Antwort: Wenn ein Kind einen kleinen Esel aus seinem Elend befreit, kann der Esel mit diesem Kind sprechen. Und solange dieses Kind lebt, bleibt auch der Esel am Leben. Das ist seit ewigen Zeiten so.“
Damit wären wir doch beim Schlusssatz von Märchen angelangt: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann …
Jedenfalls, ein Märchenbuch, in dem auch Michael Scharang sein erzählerisches Können beweist, auch wenn manche Ereignisse im Abstand von Jahrzehnten anders abliefen als geschildert. Aber in Märchen darf das wohl so sein.
Einträge 1 bis 5 von 64 | Weitere ->
